Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Laut Angaben der Stiftung Deutsche Krebshilfe erkranken in Deutschland jährlich rund 70.000 Patientinnen neu daran, Männer sind mit ca. 1% deutlich seltener betroffen. Regelmäßige Vorsorgemaßnahmen und die damit einhergehende Früherkennung von Brustkrebs können die Risiken für schwere Verläufe verringern. Für die Verbesserung der Heilungschancen sind eine frühe Diagnose, die passende Behandlung sowie weitere Fortschritte in der klinischen Forschung entscheidend.

Brustkrebs: Vorsorge, Diagnose und Forschung zu neuen Behandlungsformen
Anzeichen, Risikofaktoren und Sonderformen von Brustkrebs
Brustkrebs wird medizinisch auch Mammakarzinom genannt. Er entsteht, wenn Zellen in der Brust anfangen, sich unkontrolliert zu vermehren. Normalerweise teilen sich Zellen geordnet, aber bei Krebserkrankungen wie Brustkrebs ist dieser Prozess gestört, z.B. durch bestimmte Veränderungen (Mutationen) im Erbgut (DNA). Solche Veränderungen können zufällig passieren oder durch äußere Einflüsse wie Hormone, Alter, familiäre Veranlagung oder Umweltfaktoren begünstigt werden. Die veränderten Zellen können sich zu einem Tumor entwickeln, im schlimmsten Fall in andere Körperbereiche streuen und sogenannte Metastasen ausbilden. Das Krankheitsbild bei Brustkrebs reicht von langsam wachsenden bis hin zu aggressiveren Varianten. Typische Hinweise sind tastbare Knoten oder Verhärtungen, die sich vom gesunden Gewebe abgrenzen.
Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen genetische Mutationen, familiäre Vorbelastung, hormonelle Einflüsse, ungesunder Lebensstil und Übergewicht.
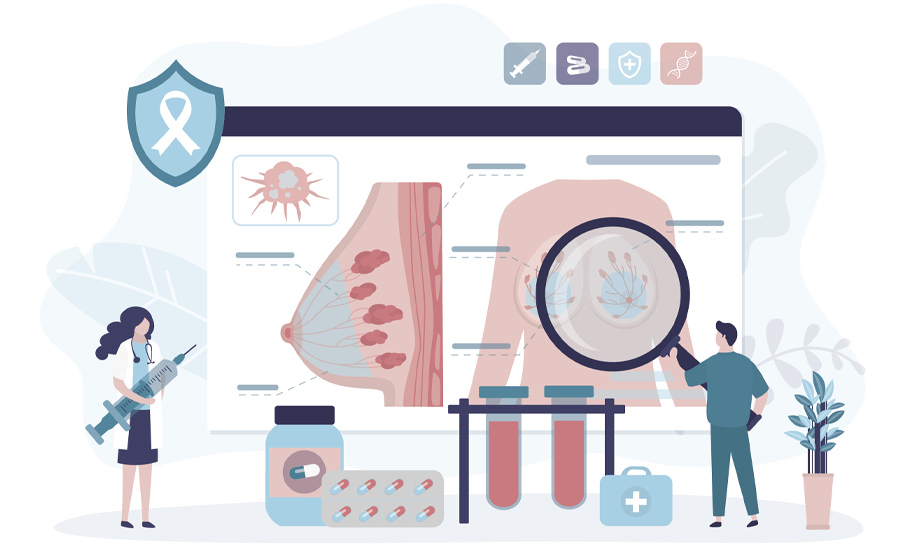
Inflammatorischer Brustkrebs: Seltenere, aber aggressivere Variante
Ist Brustkrebs inflammatorisch (entzündlich), erscheint die Brust gerötet, überwärmt und geschwollen. Diese Symptome entstehen, wenn sich die Krebszellen in den Lymphbahnen der Haut ausbreiten und dort eine Entzündung vortäuschen. Diese Form des Mammakarzinoms ist besonders aggressiv. Sie weist in mehreren Punkten deutliche Unterschiede zu anderen Brustkrebsarten auf. Diese Art tritt häufig nicht in Form einer erkennbaren Geschwulst in der Brust auf und lässt sich deshalb auch nicht immer zuverlässig bei einer Mammographie, einer speziellen Röntgenuntersuchung, nachweisen. Das macht die Diagnose schwieriger. Zudem tritt diese besondere Form von Brustkrebs häufiger bei jüngeren Frauen unter 40 Jahren auf.
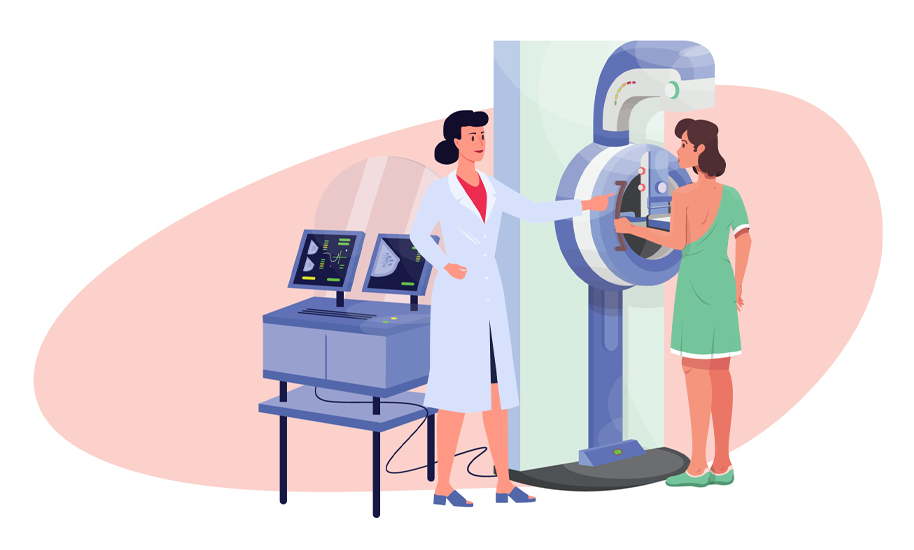
Diagnose und Vorsorgemöglichkeiten
In Deutschland wird Frauen ab dem 30. Lebensjahr eine jährliche Tastuntersuchung empfohlen. Das regelmäßige Mammographie-Screening, eine spezielle Röntgenuntersuchung zur frühzeitigen Erkennung von Brustkrebs, richtet sich an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Vor allem bei einer familiären Vorbelastung ist eine engmaschige Kontrolle sinnvoll.
Treten bei diesen Kontrollen Auffälligkeiten auf, ist eine genauere Begutachtung notwendig. Die Diagnose beginnt mit einem ärztlichen Gespräch und einer körperlichen Untersuchung. Bildgebende Verfahren wie Mammographie und Ultraschall geben wichtige Hinweise. Im Ultraschall wird Brustkrebs häufig als unregelmäßig begrenzte Struktur sichtbar. Durch die Entnahme von Gewebe (Biopsie) können vorhandene Biomarker bestimmt und eine endgültige Diagnose erstellt werden. Biomarker sind spezielle Eigenschaften von Zellen und helfen, eine passende Behandlung zu finden. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) kann als bildgebendes Verfahren ergänzend Informationen für die individuelle Therapieplanung liefern.
Therapieformen, Nebenwirkungen und Heilungschancen
Die Behandlung richtet sich nach Stadium der Brustkrebserkrankung, also wie weit die Krankheit fortgeschritten ist und verschiedenen individuellen Faktoren. Zu den etablierten Verfahren zählen Operationen zur Entfernung des Tumors oder der gesamten Brust, Chemotherapien zur Bekämpfung der Krebszellen, Hormontherapie bei hormonabhängigen Tumoren und Strahlentherapie zur Zerstörung verbliebener Krebszellen. Behandlungen gegen Krebs können Nebenwirkungen verursachen, weil sie nicht nur die kranken, sondern auch gesunde Zellen im Körper beeinflussen. Während die Strahlenbehandlung vor allem lokale Nebenwirkungen wie Hautreizungen verursachen kann, können Haarausfall, Müdigkeit und Übelkeit eine mögliche Folge einer begleitenden Chemotherapie sein. Eine mögliche vollständige körperliche und psychische Erholung kann mehrere Monate beanspruchen. Eine gezielte Rehabilitation durch spezielle Programme oder psychologische Beratung unterstützt diesen Prozess.
Heilungschancen hängen wesentlich davon ab, wie früh der Krebs entdeckt wurde und wie schnell der Tumor wächst. Während manche Karzinome über Jahre hinweg langsam wachsen, können aggressive Varianten innerhalb weniger Monate fortschreiten. In frühen Stadien ist die Genesungsperspektive aufgrund moderner Verfahren sehr gut.
Brustrekonstruktion
Nach einer Brustoperation, insbesondere wenn die gesamte Brust entfernt wurde (Masektomie) gibt es die Möglichkeit die Brust wieder aufzubauen (sogenannte Brustrekonstruktion). Dabei gibt es zwei Hauptwege, wie die Brust wieder hergestellt werden kann. Entweder geschieht dies, indem Silikonimplantate eingesetzt werden, oder indem über eine Eigengewebsrekonstruktion körpereigenes Gewebe, z.B. aus dem Bauch oder Rücken entnommen und zur Brustformung verwendet wird. Eine Rekonstruktion kann dabei direkt bei der Brustoperation stattfinden, oder auch Wochen, Monate oder sogar Jahre nach der Krebsbehandlung. Die Entscheidung hierzu hängt von der individuellen Situation, dem Gesundheitszustand und den persönlichen Wünschen ab.
Brustkrebs bei Männern
Auch Männer können an Brustkrebs erkranken, wenn auch deutlich seltener als Frauen. Typische Anzeichen sind schmerzlose Verhärtungen und Knoten in der Brust, Einziehungen der Haut oder Flüssigkeitsaustritt. Bei etwa der Hälfte der Brustkrebsfälle bei Männern sind auch die Lymphknoten in den Achselhöhlen betroffen. Da Männer seltener zur Vorsorge gehen, wird die Erkrankung oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt. Deshalb sollte beim Auftreten der genannten Symptome eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Die Behandlungsformen entsprechen weitgehend denen bei Frauen.
Klinische Forschung: Zukunft der Brustkrebs-Therapie
Die klinische Forschung ist Grundlage für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden – von zielgerichteten Medikamenten über Immuntherapien bis hin zu personalisierten Ansätzen, die die genetischen Eigenschaften des Tumors berücksichtigen. Ziel ist es, Behandlungen noch wirksamer und verträglicher zu gestalten.
